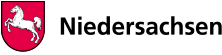Kontrollanalysen im MBA-Praxisbetrieb
Jörn Heerenklage
Die jeweiligen Abbildungen finden Sie in der zugehörigen > Präsentation (PDF, 2 MB)
1. Einleitung
In Deutschland sind seit dem 1. Juni 2005 alle Restabfälle vorzubehandeln. Die Kriterien zur Beurteilung der abzulagernden Abfälle aus einer mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage sind in der Abfallablagerungsverordnung AbfAblV [1] festgelegt. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Parameter sind regelmäßig Abfallproben zu entnehmen und zu analysieren. Nachfolgend werden Analysenergebnisse von Kontrollanalysen aus der Praxis vorgestellt und bewertet. Darüber hinaus werden ausgewählte Methoden für die Durchführung von Kontrollanalysen dargestellt und auf mögliche Modifikationen hingewiesen.
2. Anforderungen an das Ablagerungsverhalten von mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfällen
Die Anforderungen an die Behandlung und die Ablagerung der Abfälle (Siedlungsabfälle) sind in der AbfAblV zusammengefasst. Im Paragraph 4 der AbfAblV werden die Anforderungen an mechanisch-biologisch vorbehandelte Abfälle geregelt. Im Paragraph 5 der AbfAblV sind die Untersuchungs- und Nachweispflichten aufgeführt. U.a. hat der Besitzer von regelmäßig und in größeren Mengen anfallenden Abfällen aus Behandlungsanlagen dem Deponiebetreiber je angefangene 2000 Mg angelieferten Abfalls - jedoch mindestens monatlich - folgende Anforderungswerte der im Anhang 2 aufgeführten Zuordnungskriterien zu dokumentieren (siehe auch Tabelle 1):
- Organischer Anteil des Trockenrückstandes in der Originalsubstanz, analysiert als gesamter organischer Kohlenstoffgehalt (TOC) oder als oberer Heizwert ,
- TOC-Gehalt im Eluat der eluierten Probe,
- Biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes in der Originalsubstanz, analysiert als Atmungsaktivität (AT4) oder bestimmt als Gasbildungsrate im Gärtest (GB21).
Die Dokumentation ist durch Vorlage der Ergebnisse der Abfalluntersuchungen zu erbringen. Dabei sind die Abfalluntersuchungen nach Anhang 4 der AbfAblV durchzuführen. Zusätzlich hat der Deponiebetreiber stichprobenhaft Kontrollanalysen durchzuführen. Bei Nichteinhaltung der Zuordnungskriterien müssen die behandelten Abfälle in einem hierfür zugelassenen Bereich zwischengelagert werden bzw. einer erneuten Behandlung zugeführt werden.
Für den kontinuierlichen Betrieb einer MBA und der Deponie sind die ordnungsgemäße Durchführung und Zuverlässigkeit der in Tabelle 1 aufgeführten Bestimmungsmethoden von großer Bedeutung. Nachfolgend werden die Methoden vorgestellt und mögliche Schwachstellen aufgezeigt.
Tabelle 1. Ausgewählte Zuordnungskriterien des Anhangs II der AbfAblV [1]
|
Nr. |
Parameter |
Zuordnungswerte 1) |
Kontrollanalysen 2) |
|
2 |
Organischer Anteil des Trockenrückstandes in der Originalsubstanz |
< 18 Mass-% |
< 21 Mass-% |
|
6 |
- oder oberer Heizwert |
< 6000 KJ/kg |
< 7000 KJ/kg |
|
4.03 |
TOC im Eluat |
< 250 mg/l (< 300 mg/l in Vorbereitung) |
< 300 mg/l (< 600 mg/l in Vorbereitung) |
|
5 |
Biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Originalsubstanz |
||
|
- bestimmt als Atmungsaktivität AT4 oder |
< 5mg O2/g TM |
< 10 mg O2/g TM |
|
|
- bestimmt als Gasbildungsrate im Gärtest GB21 |
< 20 Nl/kg TM |
< 30 Nl/kg TM |
1) Die Einhaltung der unter §5Abs.6 nachzuweisende Einhaltung der Zuordnungswerte gilt als noch gegeben, wenn der 80% Perzentil-Wert des jeweiligen Parameters den Zuordnungswert für Kontrollanalysen nicht überschreitet und der Median aller Messwerte der letzten 12 Monate den entsprechenden Zuordnungswert eingehalten hat.
2) Bei Kontrollanalysen für mechanisch-biologisch vorbehandelte Abfälle gilt die Einhaltung der Zuordnungswerte des Anhangs II der AbfAblV als noch gegeben, wenn ein Parameter den nachfolgend aufgeführten jeweiligen Grenzwert zwar überschreitet, dieser bei den vier vorausgegangenen Kontrollanalysen jedoch eingehalten wurde.
3. Probenahme und Analytik
Nachfolgend werden die einzelnen Bestimmungsmethoden, die Probenahme und die Probenaufbereitung dargestellt, um auf mögliche Unterschiede bzw. Modifikationsmöglichkeiten im praktischen Einsatz hinzuweisen. Darüber hinaus soll die Schwankungsbreite der ermittelten Analysenergebnisse aufgezeigt werden.
Die Probenahme und die Analytik sind in der Abfallablagerungsverordnung geregelt. Dabei ist zu beachten, dass nach Einführung der Abfallablagerungsverordnung in 2001 die Vorgaben für die Probenahme und der Herstellung des Eluat durch zwei neue Vorschriften ersetzt wurden. Die für die Probenahme aufgeführte Richtlinie PN 2/78 K der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall [2] wurde durch die Richtlinie LAGA PN 98 [3] ersetzt. Die Elution nach DIN 38414, Teil 4 [4] erfolgt nun nach der Methode EN 12457-4 [5].
3.1 Probenahme
Die Durchführung der Probenahme hat einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse der nachfolgenden Analysen und ist somit entscheidend für die Beurteilung des abzulagernden Materials. Bei mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfällen ist nach der AbfAblV von homogenem Material auszugehen, was durch Sichtkontrolle zu prüfen ist. Die Probenahme sollte daher nur durch geschultes und qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
Die Durchführung der Probenahme nach der LAGA PN 98 erfolgt nach den folgenden Kriterien:
- Überprüfung der Homogenität / Heterogenität / Inhomogenität
- Volumen- / Massenbestimmung
- Ermittlung der Größtkomponente
- Festlegung der Mindestanzahl an Einzel-, Misch- und Sammelproben
- Festlegung des Mindestvolumen der Einzelproben
- Verjüngung der Laborprobe.
Bei der Beprobung eines Abfallvolumens von ca. 100 m³ sind beispielhaft 16 Einzelproben zu entnehmen, die auf 4 Misch- bzw. Laborproben zu verjüngen sind. Hierbei ist besonders auf eine sorgfältige Verjüngung z.B. durch Aufkegeln und Vierteln mittels Probenkreuz zu achten.
Das Mindestvolumen der Einzel- bzw. Laborprobe richtet sich nach der maximalen Korngröße des zu untersuchenden Abfalls. Bei einer maximalen Korngröße von 20 bis 50 mm sind je Einzelprobe 2 Liter - und für die Laborprobe 4 Liter Probevolumen vorzuhalten. Ggf. ist das Probevolumen zu erhöhen, falls dies durch die nachfolgend durchzuführenden Aufbereitungsschritte und Analysen erforderlich ist.
3.2 Probenaufbereitung
Nach Durchführung der Probenahme des zu untersuchenden Materials ist die anschließende Probenaufbereitung ein wichtiger Faktor für eine repräsentative analytische Beurteilung des Probenmaterials. Für die Kontrollanalysen ist das Probenmaterial spezifisch aufzubereiten. Hierfür sind unterschiedliche Zerkleinerungsaggregate vorzuhalten. Darüber hinaus ist der personelle Arbeitsaufwand nicht zu unterschätzen.
Für die Bestimmung der Atmungsaktivität AT4 und der Gasbildung GB21 sowie für die Durchführung der Elution ist das feuchte Probenmaterial auf einen Durchmesser von d<10mm zu zerkleinern. Das Probenmaterial sollte hierzu zunächst abgesiebt und der Überstand zerkleinert werden. Zur Zerkleinerung des feuchten Probenmaterials eignen sich insbesondere langsam laufende Zerkleinerungsaggregate, wie z.B. Zwei- bzw. Dreiwellen - Zerkleinerer. Der Zerkleinerungsgrad wird durch den Abstand der einzelnen Schneideinrichtungen bestimmt. Bei größeren Abstand der Schneideinrichtungen von z.B. 16 mm ist der Überstand der zu zerkleinernde Probe mehrfach aufzugeben. Gröbere Störstoffe wie z.B. Steine können mit Hilfe eines Backenbrechers zerkleinert werden. Dadurch kann auf eine aufwendige händische Sortierung der Störstoffe beim AT4 bzw. GB21 verzichtet werden. Metalle sind jedoch in jeden Fall auszusortieren. Hierauf wird insbesondere bei der Methodenvorschrift zur
Elution [5] hingewiesen.
Für die Bestimmung des TOC-Gehaltes im Feststoff sowie dem oberen Heizwertgehalt ist das Probenmaterial zunächst bis zur Gewichtskonstanz zu trocknen (T=105°C). Anschließend erfolgt die Zerkleinerung des Materials auf d<0,2mm in einer Schneid- bzw. Zentrifugalmühle. Falls keine vorherige Störstoffauslese stattgefunden hat, sind diese nun auszusortieren, um Schäden an den Mühlen zu vermeiden. Der Anteil der inerten Störstoffe ist dabei zu ermitteln, um diesen ggf. bei der Berechnung des TOC-Gehaltes und des oberen Heizwertgehaltes zu berücksichtigen.
Wie mit dem Anteil der Inertstoffe bei der Berechnung des Analysenergebnisses zu verfahren ist, sollte noch eindeutig festgelegt werden, um Unsicherheiten bei der Berechnung der Analysenergebnisse auszuräumen. Der Inert- bzw. Störstoffanteil liegt in der Regel zwischen 10 und 30 Gew.-% und wird somit den tatsächlichen Analysenwert signifikant beeinflussen.
3.3 Analytik
Bestimmung der Atmungsaktivität AT4
Die Bestimmung der Atmungsaktivität AT4 erfolgt bei einer Umgebungstemperatur von T=20°C über einen Untersuchungszeitraum von mindestens 4 Tagen (abzüglich der lagphase) und kann im Respirometer (z.B. Sapromat, Fa. IBUK, Fa. H&P) oder im Batchansatz mit Drucksensoren (Oxitiop, Fa. WTW) erfolgen. In beiden Testsystemen wird das durch die Mikroorganismen produzierte Kohlendioxid an Natronkalkplätzchen gebunden. Über den entstehenden Unterdruck wird der verbrauchte Sauerstoff stöchiometrisch ermittelt. In den Abbildungen 1 und 2 sind die Prinzipskizzen des Sapromats und des Oxytop-Systems dargestellt. Der Sapromat hat gegenüber dem System mit den Drucksensoren den Vorteil, dass der durch die Mikroorganismen verbrauchte Sauerstoff sofort elektrochemisch nachgeliefert wird und somit in der Regel keine Sauerstofflimitierung auftreten kann (max. O2-Produktion ca. 150mg O2/h). Die Batchansätze mit den Drucksensoren sind je nach Aktivität der Probenmaterialien zwischenzeitlich zu öffnen und mit Luft bzw. Sauerstoff zu spülen. Das Oxytop-System ist für Probematerialien höherer Aktivität daher nur bedingt geeignet, da das ständige Öffnen für den Luftaustausch zu Messungenauigkeiten führt. Nach Müller [6] geben vergleichende Untersuchungsergebnisse einen Hinweis darauf, das das Oxytop-System mit geringeren Einwaagemengen von 20g besser mit den Sapromaten korreliert als bei 40g Einwaage.
Abbildung 1. Prinzipskizze und Foto des Sapromats (Fa. IBUK) zur Bestimmung der Atmungsaktivität AT4 (nicht in der Präsentation enthalten)
Abbildung 2. Prinzipskizze des Oxitop-Testsystems (Fa. WTW) zur Bestimmung der Atmungsaktivität (AT4) (nicht in der Präsentation enthalten)
Die Einwaage des Probenmaterials beträgt 40 g Feuchtmasse (Dreifachansatz). Zuvor sind die Probenmaterialien auf einen optimalen Wassergehalt einzustellen. Dieser liegt zwischen 50-70% der maximalen Wasserhaltekapazität und soll anhand der AbfAblV mittels "Saugnutschenmethode" eingestellt werden. Im Rahmen eines Ringversuches zur Überprüfung der Stabilitätsparameter konnte festgestellt werden, dass in der Praxis oftmals die Einstellung des Wassergehaltes mit der "Faustprobe" [7] vorgezogen wird, da diese Methode wesentlich schneller ist [6]. Beim Vergleich der Wassergehaltseinstellungen konnte festgestellt werden, dass diese z.T. erheblich voneinander abwichen. Der Wassergehalt kann einen signifikanten Einfluss auf die Atmungsaktivität haben. Untersuchungen an der TUHH zur Wassergehaltseinstellung mittels Nutschenmethode und der Faustprobe haben gezeigt, dass mittels Nutschenmethode ein höherer Wassergehalt eingestellt wurde und die Atmungsaktivität um bis zu 30% anstieg gegenüber den mittels Faustprobe eingestellten Probematerialien.
Untersuchungen im Rahmen eines Ringversuches zur Überprüfung von Stabilitätskriterien in England [8] haben gezeigt, dass die AT4-Bestimmung nach der AbfAblV von Materialien mit höheren organischen Anteilen nicht unbedingt möglich ist. In vergleichenden Untersuchungen mit der in England 2005 eingeführten Testmethode des DR4 [9] konnte von insgesamt 15 beteiligten Laboratorien nachgewiesen werden, dass die AT4-Bestimmung signifikante Minderbefunde bei Untersuchungen von Abfallmaterialien mit erhöhter biologischer Atmungsaktivität liefert. Wesentliche Unterschiede zwischen der DR4- und der AT4-Methode sind, dass in der DR4-Methode ausgereifter Kompost als Impfmaterial zugegeben wird, die Temperatur T=35°C beträgt und das Material wird in Reaktoren kontinuierlich mit Luft zwangsdurchströmt wird. Es wurden 4 Abfallmaterialien mit nicht bekannter unterschiedlicher Vorbehandlungsdauer untersucht. Dabei wies das 10 Tage biologisch vorbehandelte Material anhand der AT4-Messungen nur eine sehr geringe Aktivität von 3 mg O2/gTM auf, während die Ergebnisse der DR4-Bestimmung eine Atmungsaktivität von 187 mg O2/gTM aufweisen. Parallel wurde in einem ersten Vergleichsansatz im Sapromat ebenfalls ausgereifter Kompost als Impfmaterial zudosiert und über einen Zeitraum von 4 Tagen bei T=20°C untersucht. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass der gleiche Abfall mit Impfmaterialzugabe eine Atmungsaktivität von 119 mg O2/gTM aufweist. Durch die Zugabe des Impfmaterials werden die Milieubedingungen im AT4-Ansatz optimiert. Dies ist z.B. die Optimierung des pH-Wertes, ggf. die Reduktion möglicher organischer Säuren, eine verbesserte Nährstoffversorgung sowie eine bessere Sauerstoffversorgung infolge einer verbesserten Materialstruktur.
Weitere vergleichende Untersuchungen an der TUHH haben ebenfalls gezeigt, dass die Zugabe von Impfmaterial einen entscheiden Einfluss auf die Atmungsaktivität von frischen Abfallproben haben kann. Beim Vergleich von 7 unterschiedlichen Probematerialien konnten z.T. erhebliche Unterschiede von bis zu 100% höheren Aktivitätsraten durch die Zugabe von Impfmaterial ermittelt werden. Beim Vergleich von 5 mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfallproben konnten keine signifikanten Unterschiede analysiert werden.
Da im Rahmen der mechanisch-biologischen Vorbehandlung auch Abfallproben mit höheren Aktivitäten zu untersuchen sind, z.B. um den zeitlichen Verlauf der Abnahme der Atmungsaktivität AT4 innerhalb eines gesamten Behandlungszyklus einer MBA zu untersuchen, sollte geprüft werden, ob die AT4-Bestimmung nach der AbfAblV an die Methode der DR4-Bestimmung anzupassen ist. Dies könnte einerseits die bereits erwähnte Impfmaterialzugabe sein. Andererseits ist auch zu prüfen, ob zusätzlich ein interner Standard zuzugeben ist, um die eigene Messmethodik zu überprüfen. Eine Eigenkontrolle der AT4-Bestimmungen scheint sich im Rahmen der Ringuntersuchungen zur Überprüfung der Stabilitätsparameter als hilfreich herausgestellt zu haben, da nur die Hälfte der AT4-Ergebnisse im Rahmen der statistischen Regelgrenzen lagen [6]. Die Erfahrungen des durchführenden Personals sind ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Durchführung dieser Untersuchungen.
Bestimmung der Gasbildung GB21
Die Bestimmung des Gasbildungspotenzials von mechanisch-biologisch behandelten Probenmaterialien kann im GB21-Ansatz volumetrisch mittels Eudiometer (siehe Abbildung 3) erfolgen. Darüber hinaus können auch weitere standardisierte Instrumente zur Gasmengenzählung eingesetzt werden. Das zu untersuchende Material (50 g FM) wird mit ausgefaultem Impfschlamm und Wasser über einen Zeitraum von mindestens 21 Tagen bei einer Umgebungstemperatur von T=35°C untersucht. Der Impfschlamm wird in einem Referenzansatz mit Cellulose (Avicell) hinsichtlich der biologischen Aktivität geprüft. Um einen einwandfreien anaeroben Prozess sicherzustellen, wird der freie Gasraum mit Stickstoff gespült.
Abbildung 3. Prinzipskizze des Anaeroben Testsytems (Eudiometer) der Technischen Universität Hamburg-Harburg, Institut für AbfallRessourcenWirtschaft, zur Bestimmung des Gasbildungspotenzials (GB21) (nicht in der Präsentation enthalten)
Die Milieubedingungen werden zusätzlich zu Beginn und am Ende der Untersuchungen hinsichtlich des pH-Wertes überprüft. Die Ermittlung der Gasproduktion erfolgt im Eudiometer manuell arbeitstägig. Die im Versuch ermittelte Gasproduktion wird auf Normbedingungen in l/kg TM angegeben.
Bei Untersuchungen von stabilisierten Materialien hat sich die GB21-Methode der AbfAblV in der Praxis bewährt. Sollen jedoch Materialien mit erhöhter biologischer Aktivität, wie bereits oben bei den AT4-Untersuchungen beschrieben, untersucht werden, ist der Anteil des Inokulums an der Gesamtprobe zu erhöhen, um ein "Versäuern" des Systems zu verhindern. Der VDI 4630-Entwurf [3] empfiehlt hiefür ein Verhältnis von oTSSubstrat zu oTS Impfschlamm von kleiner 0,5. Dies hat sich in umfangreichen Laboruntersuchungen als geeignet herausgestellt und sollte nach Auffassung der Autoren in die Methodenvorschrift zur GB21-Bestimmung der AbfAblV übernommen werden.
Bestimmung des TOC im Eluat
Die Bestimmung des TOC im Eluat erfolgt nach vorheriger Elution und Aufbereitung des Eluats. Das Probenmaterial ist auf einen Durchmesser von d<10mm zu zerkleinern und von Störstoffen wie Metallen zu befreien. Anschließend wird der Wassergehalt bestimmt, um für das Eluat ein Feststoff / Flüssig-Verhältnis von 1:10 einzustellen. Diese beiden Maßnahmen sind ein wesentlicher Vorteil der neuen Methodenvorschrift 12457-4 gegenüber der vorherigen Methode. Die Elution erfolgt über einen Zeitraum von 24 Stunden. Das Eluat ist anschließend zu zentrifugieren und auf einen Durchmesser von d<0,45µm zu filtrieren. Danach erfolgt die eigentliche TOC-Analyse.
Bestimmung des TOC im Feststoff
Die Bestimmung des TOC im Feststoff erfolgt nach den Vorgaben der AbfAblV. Für die Analyse wird im Vergleich zu den oben beschriebenen Methoden nur eine Einwaage von wenigen Gramm Probenmaterial eingesetzt. Eine sorgfältige Probenahme und Probenaufbereitung, wie oben beschrieben, ist außerordentlich wichtig.
Bestimmung des oberen Heizwertgehaltes im Feststoff
Die Bestimmung des oberen Heizwertgehaltes erfolgt den Vorgaben der AbfAblV. Ähnlich wie beim TOC im Feststoff wird bei der Bestimmung des oberen Heizwertgehalt nur eine sehr geringe Einwaage von ca. 1 Gramm für die Analyse eingesetzt, sodass der Probenaufbreitung eine wichtige Rolle zukommt.
Ergebnisse von Kontrollanalysen im Praxisbetrieb einer MBA
Im Rahmen von Kontrollanalysen auf einer mechanisch-biologischen Behandlungsanlage wurden vergleichende Untersuchungen von bis zu drei Laboratorien durchgeführt. Nachfolgend werden die Laboratorien mit Lab A, Lab B und Lab C abgekürzt. Den Laboratorien wurde jeweils das gleiche Probenmaterial zur Verfügung gestellt. Anschließend wurde es nach der oben dargestellten Vorgehensweise aufbereitet und analysiert. Um die Anonymität zu gewährleisten, wurden die Analysenergebnisse der einzelnen Laboratorien im vorliegenden Beitrag z.T. unterschiedlich zugeordnet. Darüber hinaus ist zu bemerken, dass während des Untersuchungszeitraumes die mechanisch-biologische Behandlungsanlage zeitweise umgebaut wurde, um den Behandlungsprozess zu optimieren. In diesen Zeiträumen wurden gegenüber dem Normalbetrieb z.T. erhöhte Konzentrationen im Output Material analysiert.
In Abbildung 4 sind die Analysenergebnisse des TOC-Gehaltes im Eluat summarisch aufsteigend aufgetragen und als relative Häufigkeit in zwei Kurven dargestellt. Einerseits wird der gesamte Untersuchungszeitraum von ca. 55 Wochen betrachtet. In einer weiteren Summenkurve wurden die Analysenergebnisse der Einfahr- und Umbauphase eliminiert, um den tatsächlichen Normalbetrieb zu bewerten. Zusätzlich sind die zurzeit gültigen Grenz- und Kontrollwerte von 250 mg/l und 300mg/l dargestellt sowie den in Vorbereitung durch den Gesetzgeber befindlichen modifizierten Grenz- und Kontrollwert von 300 mg/l und 600 mg/l.
Abbildung 4 (Folie 11). Analysenergebnisse (Mittelwerte) und relative Häufigkeit von Kontrollanalysen zum TOC im Eluat über einen Untersuchungszeitraum von ca. 55 Wochen im Output-Material einer mechanisch-biologisch Behandlungsanlage
Im "Normalbetrieb" wird der 80% Perzentil beim Kontrollwert von 300 mg/l als auch der Median des Grenzwertes nahezu eingehalten. Wird der gesamte Untersuchungszeitraum von ca. 55 Wochen inkl. der Umbau- und Optimierungsmaßnahmen an der MBA betrachtet, kann der 80% Perzentil für den herkömmlichen Kontrollwert nicht eingehalten werden. Wird jedoch der in Vorbereitung befindliche Kontrollwert von 600 mg/l herangezogen, kann der 80% Perzentil – Wert als auch der Median eingehalten werden.
In Abbildung 5 sind die Analysenergebnisse von 9 Probematerialien der drei beteiligten Laboratorien dargestellt. Die mittleren Analysenergebnisse liegen überwiegend um den Kontrollwert von 300 mg/l. Die Analysenergebnisse der einzelnen Labors weisen im Mittel eine Standardabweichung vom Mittelwert um ca. 15 % auf. Betrachtet man die Max- und Minimalwerte der Analysenergebnisse, beträgt die mittlere Abweichung ca. 90 mg/l. Dies ist von besonderem Interesse, da die Analysenergebnisse in der Größenordnung des zurzeit gültigen Kontrollwertes bzw. des durch den Gesetzgeber in der Vorbereitung befindlichen Grenzwertes von 300mg/l liegen.
Abbildung 5 (Folie 12). Analysenergebnisse TOC im Eluat im Vergleich: Analytik durch Labor A, Labor B und Labor C
In Abbildung 6 sind die Analysenergebnisse der Atmungsaktivität AT4, der Gasbildung Gb21 und des TOC im Feststoff summarisch aufsteigend aufgetragen und als relative Häufigkeit dargestellt. Der Untersuchungszeitraum beträgt ca. 55 Wochen. Alle drei Parameter halten dabei den 80% Perzentil-Wert des jeweiligen Kontrollwertes und den Median den Grenzwertes ein.
Die Analysenergebnisse von 9 Probenahmen zur Bestimmung der Atmungsaktivität der drei beteiligten Laboratorien sind in Abbildung 7 dargestellt. Als Testsysteme wurde der Sapromat als auch das Oxitop-System eingesetzt. Die Analysenergebnisse weichen z.T. signifikant voneinander ab. Die mittlere Standardabweichung beträgt ca. 20%. An drei Untersuchungstagen beträgt die Abweichung über 30%.
Abbildung 6 (Folie 13). Analysenergebnisse (Mittelwerte) und relative Häufigkeit von Kontrollanalysen zur Atmungsaktivität AT4, Gasbildung GB21 und TOC im Feststoff über einen Untersuchungszeitraum von ca. 55 Wochen im Output-Material einer mechanisch-biologisch Behandlungsanlage
Abbildung 7 (Folie 14). Analysenergebnisse der Atmungsaktivität im Vergleich, Analytik durch Labor A, Labor B und Labor C
Die Analysenergebnisse von 9 Probenahmen zur Bestimmung des TOC-Gehaltes im Feststoff der drei beteiligten Laboratorien sind in Abbildung 8 dargestellt. Bei einem mittleren TOC-Gehalt von 13,5 Gew.-% im Feststoffe liegt die mittlere Standardabweichung bei ca. 15%. Der Grenzwert von 18 Gew-% wird von allen Probematerialien eingehalten.
Abbildung 8. Analysenergebnisse TOC im Feststoff im Vergleich: Analytik durch Labor A, Labor B und Labor C (nicht in der Präsentation enthalten)
In Abbildung 9 sind die Analysenergebnisse des oberen Heizwertgehaltes summarisch aufsteigend aufgetragen und als relative Häufigkeit dargestellt. Der Untersuchungszeitraum beträgt wiederum ca. 55 Wochen. Der obere Heizwertgehalt hält dabei ebenfalls den 80% Perzentil-Wert des Kontrollwertes und den Median des Grenzwertes ein.
Abbildung 9. Analysenergebnisse (Mittelwerte) und relative Häufigkeit von Kontrollanalysen zum Oberen Heizwertgehalt über einen Untersuchungszeitraum von ca. 55 Wochen im Output-Material einer mechanisch-biologisch Behandlungsanlage (nicht in der Präsentation enthalten)
Die Analysenergebnisse von 10 Probenahmen zur Bestimmung des oberen Heizwertgehaltes der drei beteiligten Laboratorien sind in Abbildung 10 dargestellt. Der mittlere obere Heizwertgehalt der 10 Probematerialien liegt bei 6400 kJ/kg. Die mittlere Standardabweichung beträgt ca. 15 %. Da der Kontrollwert von 7000 kJ/kg im Größenbereich des mittleren oberen Heizwertgehaltes liegt, überschreiten einige wenige Analysenergebnisse diesen geforderten Wert. Als Alternativparameter kann zum oberen Heizwertgehalt der TOC im Feststoff herangezogen werden, der die Kriterien der AbfAblV einhält.
Abbildung 10. Analysenvergleich Oberer Heizwertgehalt im Output Material einer mechanisch-biologischen Behandlungsanlage: Analysen von Labor A, Labor B und Labor C (nicht in der Präsentation enthalten)
4. Zusammenfassung
Zur Beurteilung von mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfällen sind diese vor der Ablagerung auf einer Deponie nach der Abfallablagerungsverordnung hinsichtlich ihres Emissionspotenzials zu charakterisieren. Regelmäßig sind nach der AbfAblV die Parameter TOC im Feststoff (alternativ oberer Heizwert), TOC im Eluat und die Atmungsaktivität AT4 oder alternativ das Gasbildungspotenzial GB21 zu analysieren. Die einfache Anwendbarkeit und hohe Reproduzierbarkeit dieser Messmethoden verbunden mit der Probenahme und Probenaufbereitung sind außerordentlich wichtig für den kontinuierlichen Betrieb einer MBA, um einerseits den Betrieb der Behandlungsanlage zu optimieren, andererseits den Nachweis für eine ausreichende biologische Stabilisierung des abzulagernden Abfalls zu erbringen.
Anhand von Untersuchungen von drei Laboratorien werden erste Ergebnisse zu Kontrollanalysen im Praxisbetrieb einer mechanisch-biologischen Behandlungsanlage aufgezeigt und bewertet. Die Analysenergebnisse der Kontrollanalysen haben gezeigt, dass die Parameter hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben der AbfAblV eingehalten werden können. Lediglich der Parameter TOC im Eluat gilt hier jedoch als besonders schwierig einzuhalten. Die in der Vorbereitung befindlichen alternativen Grenz- und Kontrollwerte für den TOC im Eluat von 300 mg/l und 600 mg/l können nach den bisherigen Ergebnissen eingehalten werden.
Ausgewählte Bestimmungsmethoden werden beschrieben und mögliche Modifikationen aufgezeigt. Bei der Bestimmung der Atmungsaktivität ist ggf. Impfmaterial und ein interner Standard zuzugeben, um einerseits eine Hemmung bei der Analyse von z.B. biologisch aktiveren Materialien auszuschließen und andererseits eine Eigenkontrolle der Messmethodik zu ermöglichen. Für die Bestimmung der Gasbildung von Probenmaterialien mit höherer biologischer Aktivität (z.B. Inputmaterial) ist die Zugabe von Impfmaterial zu erhöhen, um ein "Versäuern" der Probe zu vermeiden.
Die vergleichenden Analysenergebnisse von mechanisch-biologisch behandeltem Material haben gezeigt, dass bei der Durchführung und Auswertung von Kontrollanalysen die Analysenergebnisse um eine mittlere Abweichung von 15-20% schwanken können. Die bei der Durchführung von Kontrollanalysen beteiligten Laboratorien sollten regelmäßig an Ringuntersuchungen teilnehmen.
Literatur
[1] Anonymus, 2001, Verordnung über die umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen, Berlin 20.02.2001, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Deutschland
[2] Anonymus, 1985: Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Abfällen – PN 2/78 K – Grundregeln für die Entnahme von proben aus Abfällen und abgelagerten Stoffen, Hrsg. Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft, Heft 9, Erich Schmidt Verlag
[3] Anonymus (2004): Vergärung organischer Stoffe, VDI-Richtline 4630, Entwurf, VDI-Gesellschaft Energietechnik
[4] Anonymus, 1984: Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser (S4), DIN 38414, Teil 4, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung (DEV), Oktober 1984
[5] Anonymus, 2002: Charakterisierung von Abfällen – Auslaugung – Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen – Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10l/kg Materialien mit einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung), EN 12457-4
[6] Müller, W. (2003): Ringversuch für die Stabilitätsparameter zur Beurteilung von mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfällen (ZI. 63 2500/3-VI/3/02). Endbericht IGW-Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen.
[7] Anonymus (1994): Methodenbuch zur Analyse von Kompost. Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (Hrsg.), Kompost-Information Nr. 222, Verlag Abfall Now e.V., Stuttgart, 1994
[8] Godley, A.; Müller, W.; Frederickson, J.; Barker, H. (2005): Comparison of the SRI and DR4 biodegradation test methods for assessing the biodegradability of untreated and MBT treated mun. solid waste. In: Tagungsband zum International Symposium MBT 2005, S. 548-558, Hrsg. M. Kühle-Weidemeier, Cuvillier Verlag, ISBN 3-86537-665-7
[9] Environment Agency (2005): Guidance on monitoring MBT and other pre-treatment processes for the landfill allowances schemes (England and Wales). August 2005. http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/acrobat/mbt_1154981.pdf
Autor:
Dipl.-Ing. Jörn Heerenklage
Technische Universität Hamburg-Harburg
Institut für AbfallRressourcenWirtschaft
Harburger Schloßstraße 36
21079 Hamburg

Artikel-Informationen
erstellt am:
29.11.2006
zuletzt aktualisiert am:
16.03.2010