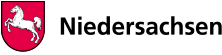Erfahrungen und Optimierungsansätze zur Einhaltung des TOC im Eluat
Joachim Dach, Andreas Warnstedt, Günter Müller
Die jeweiligen Abbildungen finden Sie in der zugehörigen > Präsentation (PDF, 220 KB)
1. Einleitung
Die am 1.6.2005 für alle Betreiber von mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen (MBA) verbindlich gewordene Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV) stellt mit ihrem Anhang 2 Anforderungen an die Beschaffenheit des zu deponierenden Materials. Neben der biologischen Aktivität (bestimmt als AT4 oder GB21) und Anteil an organischer Substanz (bestimmt als TOC oder oberer Heizwert) ist u.a. der TOC im Eluat ein Parameter für den ein Zuordnungswert festgelegt ist. Der Zuordnungswert liegt derzeit gemäß Anhang 2 AbfAblV bei 250 mg/l. Der Grenzwert nach Anhang 4 liegt bei 300 mg/l.
Weitergehend ist in Anhang 4 festgelegt, dass der Grenzwert bei den Kontrollanalysen vor der Deponierung nur überschritten werden darf, wenn die davor liegenden 4 Analysen unter dem Grenzwert lagen. Der Betreiber der MBA muss hingegen nachweisen, dass bei Überschreitungen des Grenzwertes mind. 50 % seiner regelmäßig durchzuführenden Analysen der letzten 12 Monate unter dem Zuordnungswert liegen und 80 % unter dem Grenzwert.
Der organische Restanteil bzw. der TOC im Feststoff ist vor allem im Zuge der mechanischen Aufbereitung durch einen geeigneten Siebschnitt einzustellen. Bei den anderen genannten Parametern erfolgt die Reduzierung im Wesentlichen im Verlauf der biologischen Stufe. Die Tatsache, dass sich die Einhaltung des TOC im Eluat verfahrenstechnisch als kritisch darstellt, war bereits im Zuge der Diskussion der Abfallablagerungsverordnung und des vorlaufenden BMBF-Verbundvorhabens "Mechanisch-biologische Behandlung von zu deponierenden Abfällen" bekannt. Von Seiten des BMBF-Verbundvorhabens wurde deshalb ein erreichbarer und dem Stand der Technik entsprechender und umweltverträglicher Zuordnungswert von 300 mg/l vorgeschlagen. Vor dem Hintergrund, dass Anhang 2 für Müllverbrennungsschlacken einen TOC-Eluat-Wert von 100 mg/l vorsieht, wurde jedoch ein geringerer Wert in die AbfAblV aufgenommen. Die Tendenz, dass es sich bei dem TOC im Eluat um einen kritischen Parameter handelt, bestätigen jetzt auch die Erfahrungen der zahlreichen großtechnischen MBA nach dem 1.6.2005 (vgl. Doedens et al., 2006). Dem entsprechend wird diesem Parameter erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Angekündigt und vom Bundesrat bereits beschlossen ist eine Änderung des Zuordnungswertes auf 300 mg/l und des Grenzwertes auf 600 mg/l im Zuge der Anpassung der AbfAblV.
Dieser Beitrag stellt zunächst exemplarisch die Praxiserfahrungen der MBA Singhofen vor, gibt anschließend eine kurze Zusammenfassung des Kenntnisstandes bezüglich des Parameters inklusive möglicher Einflussfaktoren. Ein weiterer Abschnitt befasst sich mit Möglichkeiten der Optimierung für die Praxis der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung, insbesondere bei aerober biologischer Behandlung.
2. Definition
TOC im Eluat ist ein Summenparameter und erfasst den Anteil des organischen Gesamtkohlenstoffs, der bei Elution nach DIN 38414-S4 bzw. DIN EN 12457-4 in Lösung geht. Der Parameter besitzt keine Aussagekraft hinsichtlich der beinhalteten Einzelsubstanzen. So können keinerlei Aussagen hinsichtlich der ökologischen oder toxikologischen Relevanz des Eluats hieraus abgeleitet werden.
Die Analysenmethoden für TOC im Eluat sind umfassend in DIN EN 1484 geregelt und beschrieben. Wesentliche Abweichungen bzw. Ergänzungen für zu analysierenden Restabfall aus mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen sind in Anhang 4 Nr. 2.4 AbfAblV zu finden und im Folgenden exemplarisch aufgeführt:
- Die Originalstruktur der einzusetzenden Probe sollte weitestgehend erhalten bleiben. Grobstückige Anteile sind zu zerkleinern.
- Die Eluatprobe ist zu zentrifugieren. Anschließend erfolgt ein einmaliges Filtrieren über Membranfilter (Porenweite 0,45 µm), ggf. mittels Druckfiltration.
3. Erfahrungen der MBA-Praxis und Versuchsergebnisse
Die MBA Singhofen (Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz) konnte aufgrund baulicher Verzögerungen nicht vor dem Stichtag 1. Juni 2005 in Betrieb genommen werden. Demzufolge mussten die Anforderungen nach AbfAblV bereits im Probebetrieb eingehalten werden. Statt einer schrittweisen Inbetriebnahme mit sukzessiv zunehmenden Mengen und der Sicherheit anfangs auftretende betriebliche Probleme nach und nach abstellen zu können, war man veranlasst praktisch ab dem Beginn des Probebetriebes die Anlage unter Volllast zu fahren. Eine große Herausforderung für alle Beteiligten.
Die MBA Singhofen verfügt über eine Mechanische Aufbereitung, in der der angelieferte Hausmüll zunächst vorzerkleinert, anschließend auf < 100 mm gesiebt und nach einer Metallabscheidung einer Homogenisierung mit gleichzeitiger Bewässerung zugeführt wird. Das so organisch angereicherte Feinkorn (< 100 mm) durchläuft anschließend eine 5-wöchige Intensivrotte in Rottetunneln (Verfahrensgeber Horstmann Recycling Technik GmbH) mit wöchentlicher Umsetzung. Dem schließt sich eine 9 bis 11-wöchige offene Nachrotte auf saugbelüfteten Trapezmieten an. Am Ende der Nachrotte muss der mechanisch-biologisch behandelte Hausmüll die Zuordnungskriterien gemäß Anhang 2 AbfAblV erfüllen. Dies war bereits bei den ersten so behandelten Abfallchargen der Fall.
Bereits die ersten Rottewochen und –monate zeigten, dass der Parameter TOC im Eluat im Verlauf der Rotte nicht zwingend monoton fällt. Chargen mit bereits niedrigen TOC-Werten zeigten teilweise im weiteren Rotteprozess wieder eine ansteigende Tendenz.
Abbildung 1(Folie 3): Verlauf des TOC im Verlauf der Nachrotte
Damit ist zunächst festzuhalten, dass der TOC im Eluat ein Parameter ist, von dem im Rotteverlauf kein stetig monoton fallendes Verhalten zu erwarten ist. Die Abbildung lässt jedoch auch erkennen, dass Chargen mit einem höheren Wassergehalt im Rotteverlauf sich signifikant besser Verhalten als Chargen mit einem geringeren Wassergehalt im Rotteverlauf.
Auf Grund von Ringversuchen ist bekannt, dass sich eine gewisse analytische Variationsbreite hinsichtlich der Analysenergebnisse ergibt. Die Ursachen liegen in der Probenahme und der Aufbereitung in den Laboren. Auf diese Thematik wurde an anderer Stelle bereits vertieft eingegangen [Warnstedt et al., 2006; Bockreis, 2006].
Die bisher gesammelten Daten wurden einer weiteren statistischen Auswertung unterzogen.
Die Darstellung in Abbildung 2 zeigt einen weitgehend linearen Zusammenhang zwischen AT4 und TOC im Eluat im gesamten Rotteverlauf. Steigende AT4-Werte gehen insgesamt mit einem ebenfalls steigenden TOC im Eluat einher.
Abbildung 2: Zusammenhang AT4 / TOC im Eluat (nicht in der Präsentation enthalten)
Im Bereich der Grenzwerte geht allerdings diese deutliche Korrelation teilweise verloren. Das heißt, ein Rückgang des AT4 ist nicht zwangsläufig mit einem Rückgang des TOC im Eluat verbunden. Auch bei geringen AT4-Werten unterhalb des Bereiches für die gültigen Grenz- bzw. Zuordnungswerte können noch TOC-Werte darüber auftreten. Umgekehrt kommt es bei Einhaltung des Grenzwertes für den TOC im Eluat praktisch nie zu Überschreitungen des Grenzwertes für die Atmungsaktivität.
Abbildung 3 (Folie 2): Zusammenhang AT4 / TOC im Eluat im Grenzwertbereich
Des Weiteren wurden alle TOC-Ergebnisse in Abhängigkeit vom Trockensubstanzgehalt aufgetragen. In nachfolgender Abbildung sind die Mittelwerte des TS-Gehalts über den gesamten Nachrotteverlauf gegenüber den Mittelwerten des TOC im Eluat über den Nachrotteverlauf aufgetragen.
Abbildung 4 (Folie 4): Zusammenhang Mittelwert Trockensubstanz über den Rotteverlaufund Mittelwert TOC im Eluat über den Rotteverlauf
Die Ergebnisse bestätigen noch einmal deutlich den Zusammenhang der auch bereits in den Rotteverläufen zu erkennen ist. Je höher der Wassergehalt desto niedriger der TOC im Eluat.
Es zeigt sich insgesamt, dass Chargen, die im Mittel über den Rotteverlauf einen TS-Gehalt von 65 Gew.-% nicht überschritten, relativ sicher den Grenzwert erreichen.
3.1 Untersuchungen zur Optimierung der Nachrotte
Neben der Optimierung des Rotteprozesses stellt sich die Frage, wie der Nachrotteoutput noch gesteuert werden kann. Vor diesem Hintergrund wurden Versuche durchgeführt, bei denen auf eine Probe aus dem Nachrotteprozess (noch nicht abschließend gerottet), wo der TOC im Eluat noch über dem Zuordnungswert liegt, eingewirkt wurde.
Da die Auswertung der betrieblichen Analysenergebnisse auf einen direkten Zusammenhang zwischen Feuchtegehalt und TOC im Eluat hinweisen, wurde der Parameter Feuchtigkeit genauer untersucht. Eine Teilmenge wurde lediglich befeuchtet. Dazu wurde vor der Analyse der Feuchtegehalt von relativ trockenen 24 Gew.-% lediglich auf 33 Gew.-% angehoben (Probe "Feucht").
In einer weiteren Teilmenge wurde der Wassergehalt auf 70 Gew.-% erhöht und anschließend überschüssiges Wasser wieder abgeschöpft. Die so entstandene Charge erhielt die Bezeichnung "Gewaschen".
Die Ergebnisse der Veränderung des Feuchtegehalts sind in Abbildung 5 zusammengefasst.
Abbildung 5: Steuerung des Nachrotteoutputs - TOC im Eluat (nicht in der Präsentation enthalten)
Die Darstellung in Abbildung 6 zeigt, dass bereits das bloße Befeuchten des Outputmaterials eine Reduzierung des TOC im Eluat um ca. 100 mg/l bewirken kann. Durch eine Waschung ließ sich sogar eine Verringerung um ca. 200 mg/l bewirken.
Zum Vergleich wurden die selben Proben auch auf AT4 untersucht. Hier stellt sich das Ergebnis anders dar. Während die Befeuchtung des Outputmaterials eine geringe Reduzierung um bis zu 1 mg O2 / g TS möglich machte, erhöhte sich der AT4 nach der Waschung jedoch deutlich.
3.2. Huminstoffproblematik
Einfluss auf den TOC im Eluat hat auch das zunehmend fokussierte Phänomen, dass sich im Verlauf der Rotte die Konzentration von Huminstoffen in der organischen Substanz und damit auch im Eluat erhöht. Der Zusammenhang der Entwicklung des TOC im Eluat und der darin enthaltenen Huminstoffe im Rotteverlauf wurde unter anderem bereits durch Lahl; Zeschmar-Lahl, 1997 dargestellt. So zeichnet sich ab, dass sich mit zunehmender Behandlungsdauer der Anteil an Huminstoffen signifikant erhöht. Dieser Effekt konnte so auch im Rotteverlauf der MBA Singhofen beobachtet werden (vgl. Tabelle 1)
Tabelle 1 Zusammenhang TOC im Eluat / Huminstoffe im Rotteverlauf
|
Einheit |
frischer Hausmüll |
Gerotteter Hausmüll |
|
|
TOC im Eluat |
mg/l |
2.590 |
350 |
|
beinhaltete Huminstoffe |
mg/l |
58 |
132 |
Huminstoffe sind neben anderen Verbindungen (wie Phenole, AOX, Chlorbenzole, Fette, Lignine, etc.) Bestandteil des TOC im Eluat. Sie entstehen durch Ab- und Umbaureaktionen von tierischem, pflanzlichem und mikrobiologischem Material, so auch bei der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung. Huminstoffe fungieren als Kohlenstoff- und Stickstoffsenke. Die anteilsmäßige Verteilung der verschiedenen Verbindungen, die den TOC im Eluat als Summenparameter ausmachen, ist bisher nur unzureichend untersucht. Analog verhält es sich mit der biologischen Abbaubarkeit sowie der ökologischen und toxikologischen Relevanz der einzelnen Verbindungen. Wolpers, 1996 gibt an, dass dahingehende Untersuchungen keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen TOC im Eluat und Schadstoffkonzentration erkennen ließen. Die Höhe des TOC im Eluat entspricht demnach nicht der Konzentration an Schadstoffen.
Huminstoffe als Vertreter der biologisch schwer abbaubaren Verbindungen im Eluat sind mit ihrer makromolekularen Struktur nur schwer abbaubar, wobei der Abbau in der Regel kometabolisch mikrobiell auf aerobem Wege z.B. durch Actinomyceten, Streptomyceten und Basidomyceten erfolgt. Für einen Abbau müssten demnach weitere Kohlenstoffquellen (z.B. aus leicht abbaubaren organischen Substanzen) zur Verfügung stehen. Bei der biologischen Abfallbehandlung erfolgt der Abbau dieser aber bereits in den ersten Rottephasen.
4. Einflussfaktoren
4.1 TOC-Bildung
Die für den TOC im Eluat maßgeblichen Prozesse sind in Abbildung 7 schematisch dargestellt.
Abbildung 6 (Folie 6): Schematische Darstellung der TOC-Bildung
Für die Konzentration der im Eluatversuch festgestellten TOC-Konzentrationen sind verschiedene Teilprozesse maßgeblich.
Die Veratmung findet prinzipiell immer aus der Flüssigphase statt. Bereits gelöste und leicht lösliche Stoffe werden zuerst veratmet. Im Verlauf der Rotte werden aus der Festsubstanz über chemische und enzymatische Hydrolyse weitere organische Substanzen gelöst und "nachgeliefert". Diese werden teilweise veratmet, teilweise werden jedoch auch schwer abbaubare Stoffe, wie Huminstoffe aufgebaut.
Der TOC im Eluat, der die zum Zeitpunkt der Probenahme in der Probe befindlichen gelösten und leicht löslichen organischen Stoffe repräsentiert, hängt nun zum einen vom Umfang der (angereicherten) schwer abbaubaren Substanzen ab und zum anderen vom Zustand des Gleichgewichts zwischen Hydrolyse und Veratmung hydrolysierter Substanz.
Um sich über die Größenordnung des Stoffumsatzes in der späten Rottephase eine Vorstellung zu machen, kann folgende Überschlagsrechnung herangezogen werden.
- Atmungsaktivität:
=> 5 mg O2/(g TS * 4d)
=> 1,25 mg O2/(g TS * d)
=> 1.250 mg O2/ (kg TS * d) - Umgerechnet auf den Kohlenstoffumsatz (bei Cellulose- / Zuckerabbau)
C6H12O6 + 3 O2 => 6 CO2 + 6 H2O
=> Molverhältnis C : O2 => (6 * 12) : (3 * 2 * 16) = 72 : 96 = 0,77 - Umgesetzte Kohlenstoffmenge
=> 1.250 mg O2/ (kg TS * d) * 0,77 C/O2 = 960 mg C / (kg TS * d)
Es werden also auch noch in der späten Rottephase rd. 1.000 mg / (kg TS * d) biologisch umgesetzt. Im Vergleich dazu der Zuordnungswert TOC im Eluat (angesetzt werden TS : H20 = 1:10).
- 250 mg C / l * 1 l / 0,1 kg TS => 2.500 mg C/ kg TS
(dies sind bei einem Abfall mit < 18 Gew.-% TOC etwa 1 bis 2 % des gesamten TOC)
Um den Zuordnungswert einzuhalten muss sich also weniger als 2.500 mg organisch löslicher Kohlenstoff pro kg TS in der Substanz befinden. Die biologische Umsetzung der organischen Substanz (o.g. rd. 1.000 mg C / kg TS * d) ist also – auch in der späten Rottephase – immer noch relativ hoch bezogen auf den Eluat-Grenzwert (umgerechnet 2.500 mg C / kg TS). Bezüglich der biologischen Reaktion bedeutet dies, dass schon bei geringfügigen Störungen der Reaktionskette (Hydrolyse schneller als Atmung) sich – auch in der späten Rottephase – der TOC im Eluat wieder ansteigen kann.
Alle Parameter, die diese Abbaukette beeinflussen, beeinflussen letztendlich die Höhe des TOC im Eluat. Dies sind primär:
- Substratqualität
- Wassergehalt
- Sauerstoffverfügbarkeit
- Temperatur
- pH-Wert
4.2 Abfallzusammensetzung / Substratqualität
In erster Linie wird die Abbaubarkeit des Restabfalls durch die Zusammensetzung des Abfalls bestimmt. Nach Kern, 2000 geht man davon aus, dass im häuslichen Restabfall bis zu 50 % organische Substanz enthalten sind. Dieser Anteil beinhaltet auch als Untergruppe die für mikrobielle Stoffwechselprozesse relevanten biogenen Substanzen.
Die Höhe des Anteils biologisch abbaubarer Organik an der Gesamtorganik entscheidet, in welchem Maß der TOC im Verlauf der Rotte reduziert werden kann. Ein weiteres Kriterium ist die Komplexität der organischen Substanzen und der daraus abzuleitende Grad der Abbaubarkeit. Es werden in der Regel leicht, bedingt und schwer abbaubare Substanzen unterschieden. Während die leicht abbaubaren Substanzen (Zucker, Stärke, ...) im Verlauf der Rotte naturgemäß zügig abgebaut werden, so sind es oft die bedingt (Fette, Cellulose, ...) und vor allem die schwer abbaubaren Substanzen (Lignin, ...), die oft erst nach langen Aufenthaltszeiten in der Rotte abgebaut werden.
Die Substratzusammensetzung am Ende der Rotte ist nur weit vorgelagerten Verfahrensschritte und natürlich durch die Abfallzusammensetzung selber zu beeinflussen. Eine reine Beeinflussung über den Siebschnitt lässt sich nach vorliegenden Erkenntnissen jedoch ableiten.
4.2 Wassergehalt / Befeuchtung
Mikrobiologischer Abbau organischer Substanz kann nur in Anwesenheit von Wasser erfolgen, da Mikroorganismen ihre Nährstoffe nur in Wasser gelöst aufnehmen können. Laut einer Recherche von Kuster, 2005 findet spätestens bei einem Wassergehalt ? 20 Gew.-% bezogen auf die Feuchtmasse keinerlei mikrobiologischer Abbau mehr statt. Andere Quellen prognostizieren diese Entwicklung bereits bei unter 30 Gew.-%. Eine allgemeingültige Aussage lässt sich jedoch nicht treffen, da neben dem Wassergehalt auch das Verhältnis von organischer und mineralischer Substanz in der Trockensubstanz von Bedeutung ist, weil an organischer Substanz deutlich mehr Wasser gespeichert werden kann als an mineralischer Substanz. Dementsprechend ist der Wassergehalt ein primärer Faktor für die erfolgreiche Reduzierung des TOC im Eluat. Ein zu hoher Wassergehalt kann zu anaeroben Bereichen im Material führen und damit den aeroben Abbau behindern, wohingegen ein niedriger Wassergehalt den mikrobiologischen Abbau insgesamt hemmt und eine ausreichende Feuchtigkeitssättigung der Rotteabluft unterbindet, was wiederum zu einem unzureichenden Wärmeaustrag aus dem Rottegut führt. Das Optimum ist stark vom jeweiligen zu rottenden Material abhängig.
In der Regel geht man davon aus, dass ein optimaler Abbau bei einem Rottegut mit einem Wassergehalt nahe der Wassersättigung erfolgt soweit noch ausreichend Luftporenvolumen verbleibt.
Während sich die Befeuchtung mit organisch belastetem Prozesswasser in den ersten Phasen der Rotte noch positiv in Form einer Anregung des mikrobiellen Abbaus auswirken kann, so ist dies in den letzten Phasen der Rotte (Nachrotte) eher als kontraproduktiv zu beurteilen, da das Prozesswasser naturgemäß bereits einen hohen Eigenanteil an löslichem TOC besitzen kann, welcher somit den TOC des Rotteguts vermutlich erhöhen würde.
4.3 Sauerstoffverfügbarkeit
Sauerstoff muss zum aeroben Abbau ausreichend zur Verfügung stehen, wobei Konzentrationen von 8 bis 12 Vol.-% nach herrschender Meinung in der Gasphase sich noch nicht hemmend auf den Abbau auswirken.
4.5 Temperatur
Der aerobe Abbau organischer Substanz erfolgt stark exotherm. Die dadurch entstehende Wärme, welche das Milieu und damit den mikrobiellen Abbau organischer Substanz beeinflusst, muss kontrolliert ausgetragen werden, damit sich ein Temperaturoptimum (i.d.R. zwischen 50 und 55°C angenommen) im Rottegut dauerhaft einstellen kann.
Besonders in der Nachrotte sollten sich keine höheren Temperaturen einstellen, da gerade hier (vorzugsweise nach langen Rottezeiten) im thermophilen Bereich Ligninabbau stattfinden kann (Kuster, 2005), was sich wiederum negativ auf die Höhe des TOC im Eluat auswirken könnte.
Für die Rotte ist nach herrschender Lehrmeinung ein Temperatur im für thermopile Bakterien günstigen Bereichen von 55 bis 60°C anzustreben. Während dieser Bereich als Optimum für den biologischen Abbau insgesamt gelten mag, ist der Parameter Temperatur im Hinblick auf den TOC im Eluat ambivalent zu sehen, da eine höhere Temperatur den Stoffumsatz insgesamt – also auch die Hydrolyse - erhöht.
5. Ansätze zur Optimierung
5.1 Prozessoptimierung
In nachfolgender Tabelle sind vor diesem Hintergrund die Vor- und Nachteile verschiedener Maßnahmen zur Beeinflussung des Prozesses im Hinblick auf den TOC im Eluat zusammengestellt.
Tabelle 2 Vor- und Nachteile betrieblicher Maßnahmen zur Beeinflussung des TOC im Eluat
|
Prozesssteuerung |
Vorteile |
Nachteile |
|
Bewässerung |
|
|
|
Umsetzen / Homogenisieren |
|
|
|
Aufenthaltsdauer |
|
|
|
Belüftung |
|
|
|
Temperatur |
|
|
Während die Einflussgrößen Bewässerung, Umsetzen / Homogenisierung und Aufenthaltsdauer weitgehend uneingeschränkt positiv für die Reduzierung des TOC eingeschätzt werden, kommt der Frage der Belüftungs- und Temperatursteuerung eine ggf. ambivalente Bedeutung zu.
Weiterhin ist die enge Überwachung und die Flexibilität des Anlagenkonzeptes eine wichtige Voraussetzung zur Steuerung des Prozesses. Chargen, die vorzeitig, also vor Erreichen der rechnerisch maximalen Aufenthaltszeit, die Zuordnungswerte einhalten, sollten dann auch aus dem Prozess ausgeschleust werden. Damit können zumindest die Aufenthaltszeiten für Chargen, die ein suboptimales Verhalten zeigen, verlängert werden. Zudem sparen kürzere Aufenthaltszeit Energie und Geld.
5.2 Weitergehende Optimierungen
Neben diesen konventionellen Strategien sind jedoch auch weitergehende Überlegungen anzustellen, wie der Prozess außerhalb der genannten Betriebsmaßnahmen und –parameter weitergehend optimiert werden kann. Hierzu nachfolgend einige gedankliche Ansätze, deren Umsetzbarkeit auch in Vorversuchen getestet wird.
5.2.1 Auswaschung
Eine andere Strategie zur Optimierung des Nachrotteoutputs stellt die Waschung des Abfalls dar. Die Ergebnisse des kleinmaßstäbigen Versuchs zeigen, dass dies für die Reduzierung des TOC im Eluat zielführend sein kann. In der Praxis ließe sich dieses Vorgehen mit hohem Aufwand technisch umsetzen. Es ist hier überlegenswert den Waschprozess am Ende der Rotte durchzuführen, da die Rotte geeignet ist, die biologisch leicht und bedingt abbaubaren Substanzen, welche bei einer vorgeschalteten Waschung entzogen würden, weitgehend umzuwandeln. Die Waschung am Ende der Rotte erfolgt mit dem Ziel einen Großteil der aufgrund Ihrer biologischen Abbaubarkeit noch nicht vollständig zersetzten organischen Substanzen aus dem Restabfall in die wässrige Phase zu überführen und damit den mechanisch-biologisch vorbehandelten Restabfall zu entfrachten. Die so entstandene verunreinigte "Waschlösung" kann anschließend als Prozesswasser, mit ggf. zwischengeschalteter Aufbereitung, in den ersten Rottewochen zugeführt werden oder aufbereitet (z.B. mit Fällmitteln) werden.
Das durch Waschung entstandene wassergesättigte Nachrotte-Outputmaterial ist hinsichtlich der Einbaueigenschaften dahingehend zu optimieren, dass es vor dem Einbau auf der Deponie noch mehrere Tage zur Entwässerung gelagert werden sollte oder anderweitig entwässert wird, damit sich der Wassergehalt auf den notwendigen Gehalt wieder reduziert.
5.2.2 Fixierung durch Adsorption / Fällung
Als geeignetes Additiv zur Adsorption von TOC–Bestandteilen könnten Tonminerale (z.B. Bentonit) in Frage kommen. Aufgrund ihrer Morphologie besitzen sie ein ausgeprägtes Ionenaustauschvermögen und eine ebensolche intrakristalline Reaktionsfähigkeit insbesondere in den Schichtzwischenräumen. Zum einen ermöglicht die hohe spezifische Oberfläche der Minerale und die Polarität der Mineralflächen ein hohes Adsorptionsvermögen z.B. für organische Stoffe an den Außenflächen. Zum anderen sind Tonminerale in der Lage Wasser, Kationen und organische Moleküle reversibel in ihre Struktur einzulagern. Organische Moleküle können adsorptiv oder kovalent an Tonminerale gebunden werden und somit organo-mineralische Komplexe bilden, die mikrobiell nur noch schwer abbaubar sind. Vergleichbar mit natürlichen Bodenprozessen können Tonminerale gemeinsam mit Huminstoffen Tonhumuskomplexe bilden, was sich gerade für die Festlegung des Anteils der schwer abbaubaren Huminstoffe am TOC im Eluat viel versprechend darstellen könnte.
Die Überprüfung der Eignung der Tonminerale zur Bindung von organischen Bestandteilen des mechanisch-biologisch behandelten Abfalls wird Gegenstand weiterer Untersuchungen sein. Wesentlich effektiver könnte sich die Zugabe eines chemischen Fällungsmittels gestalten. Dieses würde schon mit verhältnismäßig geringen Zugabemengen organische Substanzen aus dem Eluat binden. Diesbezüglich laufen derzeit Laborversuche vor dem Hintergrund der zukünftigen Übertragbarkeit in den großtechnischen Maßstab.
6. Literatur
|
[1] |
Bockreis, A. |
2006 |
Schwankungsbreiten bei der Analytik der Zuordnungskriterien (AbfAblV). Abfallforschungstage 2006, Hannover |
|
[2] |
Doedens, H.; Gallenkemper, B.; Ketelsen, K. |
2006 |
Überblick über die Einhaltung der Ablagerungswerte einzelner MBA Anlagen im Zeitraum Juni 2005 – Februar 2006. - in: MBA in der Bewährung, Internationale 6. ASA-Abfalltage. Weimar: Orbit e.V.. - ISBN 3-935974-08-6 |
|
[3] |
Eschkötter, H. |
2004 |
Die mechanisch-biologische Restabfallbehandlung als Bestandteil eines verwertungsorientierten Stoffstrommanagements. Berlin: Schmidt. – ISBN: 3-503078738 |
|
[4] |
Kern, M. |
2000 |
Potenziale zur stofflichen und energetischen Verwertung im Hausmüll. – in: Wiemer, K.; Kern, M. (Hrsg.): Bio- und Restabfallbehandlung IV. Biologisch-mechanisch-thermisch. Witzenhausen: Baeza-Verlag |
|
[5] |
Ketelsen, K.; Kanning, K., Kleemann M. |
2004 |
Aktuelle Erfahrungen mit der Planung und Realisierung von MBA. - in: Countdown 2005 – Chancen, Risiken und Möglichkeiten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, 5. ASA-Abfalltage. |
|
[6] |
Kuster, U. |
2005 |
Verbesserung der Verrottbarkeit der Feinfraktion der MBS-Anlage Samtens. Diplomarbeit am Institut für Umweltingenieurwesen, Universität Rostock |
|
[7] |
Lahl; Zeschmar-Lahl |
1997 |
Zitiert in: Doedens et al.: Wissenschaftliche Begleitung der drei Anlagen zur mechanisch-biologischen Vorbehandlung von Restabfällen in Niedersachsen, Endbericht, 2000. |
|
[8] |
Warnstedt, A., Müller, G., Dach, J. |
2006 |
TOC im Eluat als relevanter Parameter gemäß AbfAblV: Erfahrungen aus der MBA-Praxis, |
|
[9] |
Wolpers, K. |
1996 |
Aussagekraft des Parameters TOC im Eluat und Sickerwasser von vorbehandelten Siedlungsabfällen. Diplomarbeit am Institut für WAR – TH Darmstadt. |
Anschrift der Verfasser
Dr.-Ing. Joachim Dach
Bjoernsen Beratende Ingenieure
Maria Trost 3
D-56070 Koblenz
Website: www.bjoernsen.de
Dipl.-Ing. Andreas Warnstedt
Dipl.-Ing. Günter Müller
Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft
AWZ Singhofen
An der B 260
D-56379 Singhofen
Website: www.rhein-lahn-info.de

Artikel-Informationen
erstellt am:
29.11.2006
zuletzt aktualisiert am:
16.03.2010