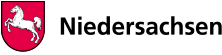Abluftbehandlung nach 30. BImSchV - erste Betriebserfahrungen und Optimierungsansätze
Dr. Rainer Wallmann, Helge Dorstewitz, Jürgen Hake, Prof. Dr. Klaus Fricke und Heike Santen
Die Abbildungen zu diesem Vortrag finden Sie in der zugehörigen > Präsentation (PDF, 3,4 MB)
Operational Experiences with the Treatment of Exhaust Air according to the Federal Immission Control Regulation (30th BImSchV)
Abstract
The first operational experiences with exhaust air treatment plants according to the 30th Federal Immission Control Regulation (30th BImSchV) show that the required exhaust air limit values can be met with sufficiently dimensioned individual components (acid washer and RTO, if necessary biofilter for partial flows of low pollution). With regard to the operational safety and to the availability of the plants closely related to it, already in the first months of the "30th BImSchV age" in part considerable problems with corrosion as well as blockages of the heat exchangers by silicon oxide in the RTO were observed. A sufficient dimensioning of the exhaust air treatment capacity as well as a redundant layout of the RTO gain considerable importance with regard to the plant availability required by the 30th BImSchV. Apart from the described technical optimization measures there are economic optimization potentials. These should be checked for the individual case when a long-term stable operation of the exhaust air treatment plants is reached, and then realized optionally.
Zusammenfassung
Die ersten Betriebserfahrungen mit Abluftbehandlungsanlagen nach 30. BImSchV zeigen, dass die geforderten Abluftgrenzwerte durch ausreichend dimensionierte Einzelkomponenten (saure Wäsche und RTO, ggf. Biofilter für geringbelastete Teilströme) eingehalten werden können. Im Hinblick auf die Betriebssicherheit und die damit verknüpfte Verfügbarkeit der Anlagen wurden bereits in den ersten Monaten des "Zeitalters der 30. BImSchV" erhebliche Probleme im Hinblick auf Korrosion und Ablagerungen an den Wärmetauschern durch Siliziumdioxid in der RTO beobachtet. Eine ausreichende Dimensionierung der Abluftbehandlungskapazität sowie eine redundante Ausführung der RTO gewinnen daher eine besondere Bedeutung in Bezug auf die Einhaltung der durch die 30. BImSchV geforderten Anlagenverfügbarkeit.
Über die beschriebenen technischen Optimierungen hinaus bestehen auch betriebswirtschaftliche Optimierungspotenziale, die nach Erreichen eines stabilen Dauerbetriebes der Abluftbehandlungsanlagen einzelfallspezifisch geprüft und umgesetzt werden sollten.
1. Einleitung/Problemstellung
Nach langjährigen Diskussionen um die Technische Anleitung (TA) Siedlungsabfall vom 1. Juni 1993 sowie die Frage nach der politischen und fachlichen Akzeptanz der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung (MBA) als Alternative zur thermischen Abfallbehandlung wurden die Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV) und die 30. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (30. BImSchV) zum 1. März 2001 rechtskräftig. Damit wurde der so genannte "Stand der Technik" für die MBA definiert.
Gemäß AbfAblV dürfen demnach ab dem 1. Juni 2005 nur noch vorbehandelte Restabfälle auf Deponien abgelagert werden, die die Zuordnungskriterien des Anhangs 1 der AbfAblV einhalten (u.a. thermisch vorbehandelte Abfälle). Für mechanisch-biologisch vorbehandelte Abfälle sind die in Anhang 2 der AbfAblV formulierten Anforderungen als Ablagerungsvoraussetzungen einzuhalten. In diesem Zusammenhang sind neben verschiedenen physikalischen Parametern und zahlreichen Schadstoffgrenzwerten im Eluat insbesondere die Parameter zur Bewertung der biologischen Stabilität (Atmungsaktivität AT4, Gasbildung GB21 und TOC im Eluat) sowie der TOC im Feststoff als Kriterium für die Effektivität der Abscheidung heizwertreicher Abfallkomponenten von Bedeutung.
Bisher sind in Deutschland ca. 50 MBA-Anlagen in Betrieb gegangen, während einzelne MBA noch in der Bauphase sind.
Im folgenden Beitrag wird dem Leser ein Überblick über die wesentlichen Inhalte der 30. BImSchV, der von der Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke & Turk GmbH durchgeführten Voruntersuchungen zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit der RTO mit vorgeschaltetem Wäscher sowie großtechnischen Betriebserfahrungen aus zahlreichen Abluftbehandlungsanlagen der MBA in Deutschland gegeben.
2. 30. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (30. BImSchV)
Die 30. BImSchV vom 1. März 2001 regelt Errichtung, Beschaffenheit und Betrieb von Anlagen, in denen Abfälle mit biologischen oder einer Kombination von biologischen mit physikalischen Verfahren behandelt werden. Betroffen sind neben Anlagen zur Erzeugung biologisch stabilisierter Abfälle vor der Deponierung oder thermischen Behandlung auch Anlagen zur Gewinnung heizwertreicher Ersatzbrennstoffe und/oder Biogas zur Verwertung. Die Verordnung gilt nicht für Anlagen, die verwertbaren Kompost oder Biogas ausschließlich aus Bioabfällen oder Erzeugnissen aus der Land-, Forst- oder Fischwirtschaft sowie aus Klärschlämmen erzeugen.
In den Paragraphen 4 und 5 wird eine vollständige Kapselung der Anlagen mit Abluftfassung und -behandlung gefordert. Paragraph 16 ermöglicht jedoch der zuständigen Behörde, bei einer mehrstufigen biologischen Behandlung eine offene Nachrotte ohne Abluftfassung und -behandlung zuzulassen, wenn
a) der zur Nachrotte vorgesehene Abfall den AT4-Wert von 20 mg O2/g TS unterschreitet und
b) "...durch sonstige betriebliche Maßnahmen sichergestellt wird, dass der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen auf andere Weise Genüge getan ist.".
Der unter a) genannte Wert für den Kapselungsgrad kann nach derzeitigem Kenntnisstand aus vorangegangenen Versuchen und dem praktischen Betrieb großtechnischer Anlagen nach 3 bis 4 Wochen Intensivrotte erreicht werden (Wallmann et al., 2005). Die folgende Nachrotte offen und ohne Abluftbehandlung zu gestalten - wie auch von den Wissenschaftlern des BMBF-Verbundvorhabens "Biologische Behandlung von zu deponierenden Abfällen" (BMBF, 2000) gefordert wurde - ist aus Sicht der Autoren als Ausnahmeregelung gemäß § 16 der 30. BImSchV grundsätzlich gerechtfertigt.
Die in § 6 der 30. BImSchV genannten Emissionsgrenzwerte sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Tabelle 1: Emissionsgrenzwerte für MBA in Deutschland (30. BImSchV)
|
Parameter |
Einheit |
30. BImSchV |
|
Gesamtkohlenstoff (TOC) |
mg/Nm³ 1) |
20/40 |
|
Gesamtkohlenstoff (TOC) |
g/Mg MBA-Input |
55 |
|
Lachgas (N2O) |
g/Mg MBA-Input |
100 |
|
Staub |
mg/Nm³ 1) |
30/10 |
|
Dioxine/Furane (PCDD/F) |
ng/Nm³ (TEQ) |
0,1 |
|
Geruch |
GE/Nm³ |
500 |
1) Tagesmittelwert/Halbstundenmittelwert
Über die genannten Abluftgrenzwerte hinaus fordert die 30. BImSchV in § 13, dass Ausfälle der Abluftbehandlungsanlage 8 aufeinanderfolgende Stunden und innerhalb eines Kalenderjahres 96 Stunden nicht überschreiten dürfen. Dies entspricht einer Mindestverfügbarkeit der Abluftbehandlungsanlage von ca. 99 Prozent.
3. Voruntersuchungen zur Abluftbehandlung nach 30. BImSchV
Vom Umweltbundesamt (UBA) wurden die in Tabelle 1 aufgeführten Abluftgrenzwerte für MBA durch die Existenz des Verfahrens der thermisch-regenerativen Oxidation (RTO) begründet. Nach Aussage des UBA stellte diese Technologie bereits im Jahr 2000 den Stand der Technik in der Abluftbehandlung dar (Fachgespräch zur MBA-Abluftreinigung am 17.04.2000 im Umweltbundesamt Berlin) und ermöglichte das Einhalten der Abluftgrenzwerte der 30. BImSchV.
In diesem Zusammenhang wurden von der Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke & Turk GmbH im Jahr 2001 umfangreiche Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit der RTO durchgeführt. In der Versuchsanordnung wurde die Abluft aus der Nachrotte von Vergärungsrückständen in zwei unterschiedlichen RTO-Versuchsanlagen - einer 3-Kammer-RTO und einer 2-Kammer-RTO - sowie einer Biofilter-Versuchsanlage behandelt. Dabei konnten folgende Ergebnisse ermittelt werden (Wallmann et al., 2001):
- Eine TOC-Reduktion < 5 mg/Nm³ ist durch Einsatz der thermisch-regenerativen Oxidation (RTO) möglich.
- Durch den im 2-Kammer-Verfahren auftretenden Rohgasschlupf beim Umschalten der Durchströmungsrichtung der RTO können Grenzwertüberschreitungen auftreten. Zum sicheren Einhalten der Grenzwerte der 30. BImSchV sind daher Anlagen nach dem sogenannten 3-Kammer-Verfahren (oder vergleichbare Verfahren) erforderlich, bei denen die Spülluft ebenfalls behandelt wird.
- Insbesondere der TOC-Frachtgrenzwert kann durch ausschließlichen Einsatz der Biofiltertechnologie nicht eingehalten werden.
- Primär während der Rotte gebildetes N2O kann nicht in nennenswertem Umfang durch die RTO reduziert werden.
- Die weitestgehende Abscheidung von Ammoniak (NH3) durch eine saure Wäsche vor der RTO ist erforderlich, um der Sekundärbildung von N2O sowie NOx in der RTO vorzubeugen. Ohne vorgelagerte Ammoniakabscheidung sind durch die NH3-Verbrennung Überschreitungen des Lachgas-Frachtgrenzwertes sowie des Geruchs-Grenzwertes (durch NH3 und bei der Verbrennung von NH3 entstehendes, ebenfalls sehr geruchsintensives NO2) zu erwarten.
- Der in der 30. BImSchV geforderte Grenzwert für Dioxine/Furane (PCDD/F) wird bereits im Rohgas sehr deutlich unterschritten. Durch die Abluftbehandlung in der RTO kommt es zu keiner signifikanten Veränderung der PCDD/F-Konzentration.
- Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass die Grenzwerte der 30. BImSchV durch die Kombination aus sauer betriebener Wäsche mit weitestgehender Ammoniakabscheidung und 3-Kammer-RTO (oder gleichwertig) eingehalten werden können.
- Im Rahmen der Versuche konnten keine Aussagen zur mittel- bis langfristigen Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden, in der 30. BImSchV geforderten, Verfügbarkeit der Abluftbehandlungsanlagen entwickelt werden.
Diese Ergebnisse wurden durch das BMBF-Verbundvorhaben "Erprobung einer nichtkatalytischen Oxidation zur Behandlung von Abluft aus der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung" (BMBF, 2002) grundsätzlich bestätigt.
4. Abluftbehandlung nach 30. BImSchV
Unter anderem auf Basis der in Kapitel 3 vorgestellten Versuchsergebnisse wurden die Abluftbehandlungsanlagen der in Deutschland errichteten MBA-Anlagen i.d.R. als Kombination aus sauer betriebener Wäsche mit nachfolgender thermisch-regenerativer Oxidation ausgeführt bzw. bei bereits bestehenden Anlagen nachgerüstet. In einzelnen Anlagen wurden aus wirtschaftlichen Gründen Biofiltersysteme zur Behandlung geringer belasteter Abluftteilströme eingesetzt. Überwiegend wurden die RTO-Anlagen redundant, also aus mehreren Behandlungslinien bestehend, ausgeführt, um die Anlagenverfügbarkeit nach 30. BImSchV einhalten zu können.
Der Vollzug der 30. BImSchV erfolgt in den einzelnen Bundesländern z.T. sehr unterschiedlich. U.a. ist bei den in Betrieb befindlichen MBA-Anlagen zu unterscheiden zwischen Anlagen, die die Vorgaben der 30. BImSchV bereits ab dem 01.06.2005, dem Stichtag gemäß AbfAblV im Hinblick auf die Abfallablagerung, einhalten müssen und sogenannten Altanlagen, deren Genehmigungsbescheid die Einhaltung der 30. BImSchV erst ab dem 01.03.2006, nach Ablauf der 5-jährigen Übergangsfrist, fordert.
Aus wirtschaftlichen Gründen ergibt sich für die Abluftbehandlung nach 30. BImSchV die Forderung nach Minimierung der zu behandelnden Abluftmengen und daher nach einem differenzierten Abluftmanagement. Dabei sind die verschiedenen Abluftströme der MBA entsprechend ihrer prozessbedingten Schadstoffgehalte stoffstromspezifisch zu behandeln.
Ziele des Abluftmanagements sind,
1. die Abluftmengen möglichst gering zu halten, z.B. durch Nutzung der Abluft aus den Bereichen Anlieferung und mechanischer Aufbereitung als Rottezuluft sowie Kreislaufführung der Abluft in der Intensiv- und Nachrotte und
2. die Schadstoffkonzentrationen der einzelnen Abluftströme effektiv zu reduzieren, um am Abluftkamin mit der Summe aller Abluftströme die Grenzwerte der 30. BImSchV einzuhalten.
Wie in Abbildung 3 dargestellt, sind Abluftströme aus folgenden Anlagenbereichen der MBA zu betrachten:
- Abfallanlieferung,
- Mechanische Aufbereitung,
- ggf. Abfallvergärung,
- Intensivrotte und
- Nachrotte.
Abbildung 1: Abluftmanagement der MBA - Schematische Darstellung (nicht in der Präsentation enthalten)
Die in den Bereichen Abfallanlieferung und Mechanische Aufbereitung entstehende Abluft (durch Absaugung der Hallen und einzelner Aufbereitungsaggregate) kann als Zuluft für die Rotte eingesetzt werden. Eventuell können geringer belastete Teilströme, z.B. aus der Abfallanlieferung, auch direkt dem Abluftkamin zugeführt werden, wobei u.U. eine Entstaubung erforderlich sein könnte. Durch Kreislaufführung von Teilströmen der Abluft während der Rotte kann die Gesamtabluftmenge ebenfalls verringert werden. Dabei wird jedoch eine Kühlung der Umluft erforderlich, um den biologischen Abbauprozess im angestrebten Temperaturbereich zwischen 50 und 65 °C betreiben zu können. Durch die Kreislaufführung der Rotteabluft steigt der CO2-Gehalt an, während die O2-Konzentration in der Abluft abnimmt. Bis zu einem Restsauerstoffgehalt von 5 % sind nach BMBF (2002) keine Abbauhemmungen zu befürchten.
Die Behandlung der Abluft erfolgt i.d.R. durch eine Kombination aus saurer Wäsche und RTO. Darüber werden in einzelnen Anlagen auch Teilströme mit geringeren Kohlenstoffgehalten - z.B. Hallenabluft - mittels kostengünstigerer Biofiltersysteme gereinigt. Am Kamin werden die unterschiedlich behandelten Abluftströme zusammengeführt und müssen in der Summe die Grenzwerte der 30. BImSchV unterschreiten, wobei die Grenzwerte für Konzentration und Fracht an Kohlenstoff als wesentliche Rahmenbedingungen anzusehen sind (Abbildung 1).
Neben der Bereitstellung von Biogas als regenerativen Energieträger stellt die Integration einer Vergärungsstufe einen wesentlichen Vorteil auch im Hinblick auf die Minimierung der spezifischen Abluftmengen dar, da ein wesentlicher Teil des biologischen Abbaus nahezu abluftfrei erfolgt.
5. Erste Betriebserfahrungen
Nachdem nunmehr zahlreiche MBA’s den Betrieb aufgenommen haben, liegen die ersten Betriebserfahrungen aus großtechnischen Anlagen zur Abluftbehandlung nach 30. BImSchV vor, die in den folgenden Kapiteln zusammenfassend beschrieben werden.
5.1 Abluftgrenzwerte
Die ersten Betriebserfahrungen zeigen, dass die geforderten Abluftgrenzwerte, wie bereits auf Basis der durchgeführten Voruntersuchungen in Kapitel 3 festgestellt, durch ausreichend dimensionierte Einzelkomponenten (saure Wäsche und RTO, ggf. Biofilter für gering belastete Teilströme) eingehalten werden können. Dies bezieht sich sowohl auf die gemäß 30. BImSchV kontinuierlich zu überwachenden Emissionsparameter Gesamtkohlenstoff (TOC; Konzentration und Fracht), Lachgas (N2O) und Staub sowie auf die diskontinuierlich zu messenden Parameter Geruch und Dioxine/Furane (PCDD/F).
Konkrete Messergebnisse einer deutschen MBA mit zweistufiger Abluftbehandlung, bestehend aus sauer betriebener Wäsche und thermisch-regenerativer Oxidation (RTO) sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 aufgeführt.
Tabelle 2 (Folie 4): Kontinuierlich überwachte Emissionsparameter einer realen MBA-Beispielanlage
In Tabelle 2 sind die Mittelwerte der kontinuierlich zu überwachenden Abluftparameter Gesamtkohlenstoff, Lachgas und Staub für den Betrachtungszeitraum von der Kalibrierung der Messeinrichtung bis zum Jahresende 2005 im Vergleich zu den Grenzwerten der 30. BImSchV aufgeführt. Es wird deutlich, dass alle Grenzwerte sehr deutlich unterschritten werden. Darüber hinaus ist anzumerken, dass alle Halbstunden-, Tagesmittel- sowie Monatsfrachtwerte im Betrachtungszeitraum unterhalb der Grenzwerte lagen. Lediglich ein einzelner TOC-Halbstundenmittelwert lag aufgrund einer kurzfristigen Störung über dem Grenzwert von 40 mg/Nm³, während die restlichen 9.774 vom Emissionsrechner ermittelten TOC-Halbstundenmittelwerte sicher unter dem Grenzwert lagen.
In Tabelle 3 sind die Mittelwerte der gemäß 30. BImSchV diskontinuierlich zu überwachenden Abluftparameter Geruch und Dioxine/Furane sowie der Mittelwert der durchgeführten Stickoxidanalysen für das Jahr 2005 aufgeführt. Sowohl die ausgewiesenen Mittelwerte als auch alle durchgeführten Einzelmessungen lagen deutlich unter den Grenzwerten.
Eine besondere Bedeutung besitzt dabei die Tatsache, dass alle in 2005 durchgeführten Einzelmessungen für Dioxine/Furane den Grenzwert von 0,1 ng/Nm³ um den Faktor 25 bis 38 unterschritten haben. Dies entspricht Grenzwertausschöpfungsraten von 2,6 bis 3,9 Prozent und bestätigt die bereits aus Vorversuchen vorliegenden Erkenntnisse (siehe Kapitel 3). Vor diesem Hintergrund empfehlen die Autoren, für die Emissionsüberwachung im Zeitraum ab 12 Monate nach Inbetriebnahme, die in § 11, Abs. 1 und Abs. 2 der 30. BImSchV geforderte Durchführung von mindestens 3 Einzelprobennahmen bzw. -analysen für Dioxine/Furane je Einzelmessung durch eine Einzelprobenahme bzw. –analyse zu ersetzen, wenn die Messungen der ersten 12 Betriebsmonate entsprechend deutlich unter dem Grenzwert liegen. Vor dem Hintergrund, dass eine einzelne Dioxinanalyse bis zu 2.000 Euro kostet, könnten den Gebührenzahlern allein durch diese Umstellung erhebliche Kosten erspart werden, ohne ein relevantes ökologisches bzw. ökotoxikologisches Risiko einzugehen.
Tabelle 3 (Folie 5): Diskontinuierlich überwachte Emissionsparameter einer realen MBA-Beispielanlage
Einfluss des pH-Wertes im Wäscherwasser auf Lachgas- und Geruchswerte
Abweichungen von den für den Regelbetrieb der Abluftbehandlungsanlagen definierten Rahmenbedingungen wie z.B. der Brennkammertemperatur der RTO oder dem pH-Wert im Wäscherwasser können spontan zu erhöhten Abluftkonzentrationen bis hin zu Grenzwertüberschreitungen bei den Parametern Lachgas und Geruch führen. Der Einfluss des pH-Wertes im Wäscherwasser auf die Lachgaskonzentration im Reingas nach RTO ist in Abbildung 2 dargestellt.
Im betrachteten realen Fallbeispiel wurde gegen 15:30 Uhr der Umsetzer in der Rottehalle in Betrieb genommen. Durch den Umsetzvorgang ist die Ammoniakkonzentration in der Abluft deutlich angestiegen, wodurch sich die Effizienz der Ammoniakabscheidung im Wäscher verringerte. Die Verbrennung des in die RTO gelangenden Ammoniaks führte zu dem in der ersten Hälfte von Abbildung 2 dargestellten leichten Anstieg der Lachgaskonzentration auf bis zu 8 mg/Nm³, wodurch das Einhalten des N2O-Frachtgrenzwertes jedoch nicht gefährdet war. Diese umsetzungsbedingte Dynamik der Lachgaskonzentration im Reingas wird im Regelbetrieb der MBA bei einem pH-Wert um 4,5 beobachtet. Gegen 22 Uhr fiel dann die Säuredosierpumpe aus, wodurch der pH-Wert im Wäscherwasser auf ca. 6,7 anstieg (Abbildung 1). Dies hatte zur Folge, dass sich die Effektivität der Ammoniakabscheidung des Wäschers verringerte, eine erhöhte Ammoniakfracht in die RTO gelangte und dort weitestgehend oxidiert wurde. In Folge dessen kam es zu einer sprunghaft ansteigenden Lachgaskonzentration im Reingas nach der RTO. Nachdem die Säuredosierpumpe am nächsten Vormittag wieder in Stand gesetzt war, wurde der pH-Sollwert von 4,5 im Wäscherwasser wieder erreicht, wodurch die Lachgaskonzentration im Reingas nach RTO erneut unter 10 mg/Nm³ sank. Im Hinblick auf den Lachgas-Monatsfrachtwert hatte dieser Vorfall jedoch keinen nennenswerten Einfluss.
Abbildung 2 (Folie 7): Zusammenhang zwischen pH-Wert im Wäscherwasser und Lachgaskonzentration im Reingas nach RTO
Zur effektiven Ammoniakabscheidung sind i.d.R. pH-Werte zwischen 2,5 und 4,5 im Wäscherwasser erforderlich. Die konkrete Definition des pH-Wertes muss jedoch im Einzelfall auf Basis der anlagenspezifischen Rahmenbedingungen, wie z.B. Ammoniakfracht im Rohgas, Volumen des Wäschers bzw. des im Umlauf befindlichen Wasservolumens sowie der Konzentrationen an Ammoniak im Abluftstrom zwischen Wäscher und RTO und Lachgas im Reingas nach RTO, vorgenommen werden.
5.2 AnlagenverfügbarkeitIm Hinblick auf die Betriebssicherheit und die damit zusammen hängende Anlagenverfügbarkeit wurden in den ersten Betriebsmonaten verschiedene Problembereiche erkannt. Die Symptome werden im Folgenden kurz beschrieben.
a) Korrosion und Ablagerungen
An verschiedenen Roh- und Reingas führenden Abluftleitungen, Ventilen und Klappen sowie an Ventilatoren, die mit unbehandelter oder behandelter Abluft in Kontakt kommen, wurden Korrosion und z.T. Ablagerungen beobachtet. Als Ursache sind vermutlich die vielfältigen schwefel-, fluor- und chlorhaltigen Schadstoffverbindungen in Kombination mit der weitestgehend gesättigten Luftfeuchtigkeit der MBA-Abluft sowie u.U. auch die Verschleppung von Säure aus dem Wäscher in die RTO aufgrund eingeschränkter Funktion der Tropfenabscheider zu betrachten.
In verschiedenen Anlagen wurden bereits Einzelteile durch Ausführungen in höherwertigeren Materialklassen ersetzt bzw. Spezialbeschichtungen aufgetragen, wodurch die Korrosionsproblematik zumindest entschärft wurde. Als weitere Möglichkeit zur Vorbeuge gegen Korrosion kann das Auftreten von Kondensaten in den sensiblen Anlagenbereichen durch gezielte Temperatursteuerung mit entsprechendem Einfluss auf die relative Luftfeuchte minimiert werden. In diesem Zusammenhang kommt auch einer optimalen Gestaltung der Wärmeisolierung der RTO eine besondere Bedeutung zu, um Kältebrücken mit entsprechender Kondensatbildung weitestgehend zu vermeiden.
Zur abschließenden Bewertung der Korrosion und Ablagerungen sowie insbesondere zur Entwicklung von betrieblichen Schutzmaßnahmen sind weitere Betriebserfahrungen erforderlich.
b) Siloxane
Die im Abfall enthaltenen organischen Siliziumverbindungen (Siloxane) gelangen z.T. über das Rohgas in die Brennkammer der RTO und werden bei Temperaturen um 850 °C weitestgehend zu Siliziumdioxid (SiO2) oxidiert. An der Oberfläche der RTO-Wärmetauscher lagert sich das SiO2 flächig an und führt mit zunehmender Betriebsdauer zu Verstopfungen der Luftkanäle der Wärmetauscher, die i.d.R. als Wabenkörper ausgeführt sind (Abbildung 3). Dies hat ansteigende Druckverluste der RTO zur Folge und kann letztendlich bis zum Hochschleudern bzw. Beschädigen einzelner Elemente der obersten Wabenkörperschicht führen.
Abbildung 3 (Folie 8): Keramik-Wabenkörper als Wärmetauscher in der RTO; links im Originalzustand (2 mm Schenkellänge innen), rechts mit Ablagerungen von Siliziumdioxid
Siloxan-Konzentrationen in MBA-Abluft
In Tabelle 4 sind die im Rohgas von 6 großtechnischen MBA-Anlagen seit Mitte 2005 gemessenen Konzentrationen organischer Siliziumverbindungen bzw. Silizium aus organischen Siliziumverbindungen aufgeführt. Es fällt auf, dass die Werte innerhalb einzelner Anlagen, aber auch zwischen den Anlagen z.T. sehr stark streuen. Zusammenfassend kann jedoch berichtet werden, dass die Daten für organische Siliziumverbindungen mit einem Schwerpunkt im Bereich zwischen 1 und 3 mg/Nm³ schwanken, während der reine Siliziumanteil der organischen Siliziumverbindungen i.d.R. zwischen 0,5 und 1,3 mg/Nm³ (entspricht einem Siliziumanteil von ca. 50 % der Siliziumverbindungen) liegt (Tabelle 4).
Tabelle 4 (Folie 9): Organische Siliziumverbindungen in MBA-Abluft (Rohgas) - Übersicht aktueller Messergebnisse an verschiedenen großtechnischen Anlagen
Im Rahmen des BMBF-Verbundvorhabens wurden in verschiedenen MBA-Abluftströmen ebenfalls Siliziumkonzentrationen bis zu 2,5 mg/Nm³, bezogen auf den Siliziumanteil, ermittelt (BMBF, 2002).
Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten zur Reduktion der Siloxane in der Abluft bzw. zur Verhinderung der Anlagerung von SiO2 an der Wärmetauscheroberfläche untersucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist jedoch davon auszugehen, dass die beschriebene Problematik regelmäßige Reinigungen der Wärmetauscher in Intervallen zwischen 3 und 9 Monaten erfordern wird. Der gesamte Reinigungsvorgang inkl. Abkühlen und erneutem Anfahren der RTO auf Betriebstemperatur führt nach derzeitigen Erfahrungswerten zu Anlagenausfällen zwischen 2 und 3 Tagen je RTO-Linie. Bei redundant ausgeführten RTO-Anlagen erfolgt die Reinigung der einzelnen Linien nacheinander, wodurch zumindest die Behandlung eines reduzierten Abluftstromes weiterhin gewährleistet ist und daher durch die Reinigung kein für die Verfügbarkeit der Abluftbehandlung gemäß §13 der 30. BImSchV relevanter Anlagenausfall auftritt.
Siloxanabscheidung im sauren Wäscher
Im Rahmen der Ermittlung der in Tabelle 4 dargestellten Siliziumkonzentrationen im Rohgas der MBA wurden z.T. auch gezielt zeitgleiche Messungen vor und nach sauer betriebenen Luftwäschern durchgeführt, um die Silizium-Abscheiderate der Wäscher zu bestimmen. Dabei wurden unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Während erste Ergebnisse darauf deuteten, dass durch die saure Wäsche bei pH-Werten um 3,5 nennenswerte Abscheideraten von bis zu 50 % möglich sind, wurden in 2 weiteren Versuchen Siliziumreduktionen von ca. 20 % erreicht (pH-Wert 3 bis 3,5). In einem Versuch konnte keine Abscheidung von organischen Siliziumverbindungen durch die saure Wäsche bei pH-Werten zwischen 3,5 und 4,5 beobachtet werden. Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die saure Wäsche im pH-Bereich > 3,5 vermutlich keine nennenswerte Siloxanabscheidung aus dem Rohgas erfolgt. Weitere Versuche mit niedrigeren pH-Werten sollten durchgeführt werden.
c) Frostprobleme
Durch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt traten im Winter 2005 an verschiedenen Anlagen Frostprobleme insbesondere im Bereich der Abluftklappen und -ventile auf, die z.T. zu kurzfristigen Anlagenstillständen führten. Durch zusätzliche Isolierungen und Begleitheizungen sowie in einzelnen Anlagen durch Erhöhung der Trocknungskapazitäten für die zur Klappensteuerung eingesetzte Druckluft konnten die beschriebenen Probleme behoben werden.
d) Brenngasversorgung
Der Stabilität der RTO-Gasversorgung kommt - insbesondere bei der Verwendung von Bio- oder Deponiegas - im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Abluftbehandlungsanlage, sowie der damit zusammenhängenden Belüftung der aeroben biologischen Behandlungsstufen, ebenfalls eine sehr hohe Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang kann das Risiko von Anlagenausfällen durch eine redundante Gasversorgung minimiert werden. Bei Einsatz von Deponie- oder Biogas wird daher empfohlen, eine alternative Brenngasversorgung für Störfälle durch Erd- oder Flüssiggas vorzusehen.
e) Brenngasqualität
Insbesondere beim Einsatz von Deponie- und Biogas als Brenngas in der RTO traten z.T. Schwierigkeiten durch schwankende Drücke, Feuchte und korrosive Verbindungen (z.B. Schwefelwasserstoff) auf. Durch technische Nachrüstungen bzw. Optimierungen konnten diese Probleme jedoch in den ersten Betriebsmonaten weitestgehend sinnvollen Lösungen zugeführt werden.
6. Zusammenfassung
Die ersten Betriebserfahrungen mit Abluftbehandlungsanlagen nach 30. BImSchV zeigen, dass die geforderten Abluftgrenzwerte durch ausreichend dimensionierte Einzelkomponenten (saure Wäsche und RTO, ggf. Biofilter für geringbelastete Teilströme) eingehalten werden können. Im Hinblick auf die Betriebssicherheit und die damit verknüpfte Verfügbarkeit der Anlagen wurden bereits in den ersten Monaten des "Zeitalters der 30. BImSchV" erhebliche Probleme im Hinblick auf Korrosion und Ablagerungen an den Wärmetauschern durch Siliziumdioxid in der RTO beobachtet. Eine ausreichende Dimensionierung der Abluftbehandlungskapazität sowie eine redundante Ausführung der RTO gewinnen daher eine besondere Bedeutung in Bezug auf die Einhaltung der durch die 30. BImSchV geforderten Anlagenverfügbarkeit.
Über die beschriebenen technischen Optimierungen hinaus bestehen auch betriebswirtschaftliche Optimierungspotenziale, die nach Erreichen eines stabilen Dauerbetriebes der Abluftbehandlungsanlagen einzelfallspezifisch geprüft und umgesetzt werden sollten.
7. Literatur
ASA, 2005: MBA Steckbriefe 2005/2006 der Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung (ASA) e.V., Februar 2005
BMBF (2000): BMBF-Verbundvorhaben "Biologische Behandlung von zu deponierenden Abfällen", Förderkennzeichen 1470960
BMBF (2002): BMBF-Verbundvorhaben "Erprobung einer nichtkatalytischen Oxidation zur Behandlung von Abluft aus der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung", Förderkennzeichen 0330240 und 03361257
Wallmann, C. Cuhls, J. Frenzel, J. Hake und K. Fricke (2001): Nachrotte von Vergärungsrückständen aus dem Valorga-Verfahren, Müll und Abfall 11, Seite 624 - 628
Anschriften der Verfasser
Dr.-Ing. Rainer Wallmann, Helge Dorstewitz und Jürgen Hake
Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke & Turk GmbH (IGW)
Bischhäuser Aue 12
D-37213 Witzenhausen
Telefon +49 5542 9308-16
Email: r.wallmann@igw-witzenhausen.de
Internet: www.igw-witzenhausen.de
Prof. Dr. K. Fricke und Heike Santen
Abteilung Abfallwirtschaft im Leichtweiß-Institut der TU Braunschweig
Beethovenstrasse 51a
D-38106 Braunschweig
Internet: www.tu-bs.de/wastemanagement
Stichwörter
- Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung (MBA),
- Abluftbehandlung,
- 30. BImSchV,
- thermisch-regenerative Oxidation (RTO),
- saure Wäsche,
- Anlagenverfügbarkeit.
Keywords
- mechanical-biological treatment (MBT),
- exhaust air treatment,
- 30th Federal Immission Control Regulation (30th BImSchV),
- regenerative thermal oxidation (RTO),
- acid washer,
- availability of the plants.

Artikel-Informationen
erstellt am:
29.11.2006
zuletzt aktualisiert am:
16.03.2010